«Wichtig ist das Engagement, nicht das Geschlecht.» – «Man muss froh sein, überhaupt willige Leute zu finden.» Es wird schnell emotional beim Thema Frauen- bzw. Männeranteil. Und die Sache ist komplex. Auch dieser Artikel wird nie alle Aspekte erfassen können, sondern höchstens eintauchen und sich umschauen, um mit dem einen oder anderen Fund wieder an die Oberfläche zu kommen. Eine Umfrage in der Gantrischregion zeigt, dass sich ein Hinschauen lohnt.
Klare Männermehrheit
Das Verteilgebiet dieser Zeitung umfasst 21 Gemeinden. In einer davon hat der Gemeinderat eine Frauenmehrheit (Schwarzenburg). Immerhin fünf Gemeinden weisen eine Frauenquote von rund 40 % in ihrer Exekutive auf, also zum Beispiel drei Frauen und vier Männer oder zwei Rätinnen und drei Räte. Doch es bleiben 15 Gemeinden mit einer tieferen Frauenvertretung. Etwa Kirchdorf mit zwei Frauen von sieben Gemeinderatsmitgliedern oder Plaffeien mit zwei Frauen und sieben Männer. In Toffen und Jaberg gesellt sich zu vier Gemeinderäten jeweils eine Frau – in Jaberg ist es die Gemeindepräsidentin. Insgesamt hat ein Drittel der untersuchten Gemeinden nur eine einzige weibliche Vertreterin im Rat. Extrembeispiele sind Belp, Rüschegg und Thurnen mit je einer Frau im siebenköpfigen Rat – spätestens hier stellt sich unweigerlich die Frage: Ist die Hälfte der Bevölkerung – die Frauen – wirklich angemessen vertreten?
Karriere-Männer und Familienfrauen
«Es gibt viel Forschung zur Frage, warum Frauen in der Politik meist in der Minderheit sind.» Prof. Dr. Isabelle Stadelmann-Steffen ist Professorin für Vergleichende Politik an der Universität Bern. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die politische Verhaltens- und Einstellungsforschung. Sie sprach zum Beispiel in einem SRF-Podcast zum Thema «Machen Frauen anders Politik?» oder war Co-Autorin des Artikels «Männer rund doppelt so häufig an Gemeindeversammlungen». Sie erklärt, dass man das Angebot und die Nachfrage anschauen müsse. Beim ersten Punkt ist erwiesen, dass Frauen weniger ausgeprägte politische Ambitionen haben und sich weniger für ein politisches Amt zur Verfügung stellen. Gleichzeitig habe die Nachfrageseite mehrere Punkte, die den Frauen wie Steine im Weg liegen. Es werde etwa von den Parteien aufgestellt, wer schon vorher viel gemacht hat, etwa in Kommissionen, in der Feuerwehr, und – nicht zu unterschätzen – im Beruf. Meist sind es die Männer, die trotz Familie und dank dem Zurückstecken ihrer Partnerin Karriere gemacht, Berufserfahrung gesammelt und sich bereits politisch engagiert haben. Hinzu kämen die meist abends angesetzten Sitzungstermine. Das alles habe viel mit der traditionellen Rollenverteilung zu tun, die gerade im ländlichen Raum vorherrschend sei, erläutert Stadelmann. Männer hätten abends nach der Arbeit eher Freizeit, während viele Frauen nebst einem Teilzeitpensum immer noch hauptsächlich für den Haushalt und die Kinder verantwortlich seien oder sich um betagte Eltern kümmern. «Hier hilft die Angleichung im Arbeitsmarkt nicht», kommentiert sie. «Die klassischen Ansätze, wonach es mit mehr Ressourcen auch mehr Partizipation gäbe, gelten nur für Männer.»

Ländlich, bürgerlich, traditionelle Rollen
Studien zeigen weitere Gründe auf, weshalb Frauen politisch weniger aktiv sind. Fehlende Bildung oder Berufserfahrung könne bei Frauen dazu führen, dass sie sich ein politisches Amt gar nicht zutrauen. Und auf dem Land – so auch in der Region Gantrisch – sind bürgerlich ausgerichtete Parteien stärker verankert als linke. Dabei sind letztere gerade diejenigen, welche am ehesten bewusst Frauen fördern – Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Milizsystem ist ebenfalls anfällig für Ungleichheit. «Gemeindepolitik ist unattraktiv geworden», so die Politologin. «Auch die Gemeinderäte sind kein repräsentativer Ausschnitt der Bevölkerung, Jüngere sind generell untervertreten.» Der Aufwand in einem Gemeinderat sei grösser geworden, aber nach wie vor oft nicht genügend bezahlt. «Darum kann generell nur eine selektive Gruppe überhaupt Ämter übernehmen.» Frisch Pensionierte etwa – tendenziell diejenigen, die nicht auch noch Care-Arbeit für Eltern oder Grosskinder übernehmen – oder Berufstätige wie Landwirte oder Anwälte, die sich trotz hohem Pensum die Zeit freier einteilen können. Pensionierte Männer verfügten meist über Netzwerke, seien verankert und hätten keinen Druck mehr, Geld verdienen zu müssen. Die über 65-jährigen Frauen hingegen seien zum Teil noch ohne Frauenstimmrecht sozialisiert worden. «Die meisten waren ihr Leben lang in traditioneller Rollenverteilung. Wenn eine Frau hauptsächlich Hausfrau war, hat sie oft das Gefühl, über nicht genug Wissen und Fähigkeiten für ein politisches Amt zu verfügen.» Hinzu kommt, dass bei Persönlichkeitswahlen eher Männer gewählt würden. Stadelmann weiss aus Studien: «Im ländlichen Kontext gibt es Vorbehalte von Wählerinnen und Wählern. Man denkt, der Mann kann es besser. Und Männer trauen es sich auch eher zu und stellen sich eher zur Verfügung.»
Spielt das Geschlecht eine Rolle?
Doch wie wichtig ist es eigentlich, ob ein Mann oder eine Frau die Finanzplanung macht, über die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen entscheidet oder die Ortsplanungsrevision vorantreibt? «Es gibt unterschiedliche Thesen dazu, was eine gute Repräsentation der Bevölkerung ausmacht», so Isabelle Stadelmann. «Ein Ansatz sagt, dass nur diejenigen, die präsent sind, auch ihre Interessen einbringen können.» Frauen, Männer, Junge, Alte: Alle sollten anteilsmässig vertreten sein, sonst gehen ihre Interessen unter. Eine andere Perspektive hingegen sei die substanzielle Repräsentation, die aufs Resultat schaut. «Hier ist es weniger klar. Es kann auch ein Mann Fraueninteressen vertreten, ohne dass das Resultat anschliessend schlechter für diese ist», erläutert sie. Manche Studien zeigten zwar, dass Frauen andere Präferenzen haben, eher grün und sozial seien. «Aber ein linker Mann ist einer linken Frau näher als eine rechte Frau.» Zudem, betont Stadelmann: «Frauen sind, wie Männer auch, keine homogene Gruppe. Es gibt nicht so etwas wie ‹Das Fraueninteresse›.» Dennoch komme grundsätzlich klar hervor, dass eine gute Demokratie dafür sorgen sollte, dass alle Gruppen ihrer Stärke entsprechend vertreten sind. Ein positiver Nebeneffekt davon sei: «Wie auch in der Wirtschaft gibt es klare Hinweise darauf, dass gemischte Teams ausgewogenere Resultate zustandebringen.» Befragungen zeigten Geschlechterunterschiede auf: Frauen sind konsensualer, können eher Kompromisse eingehen, legen weniger Wert auf Macht. «Doch die Frage stellt sich: Ist es aufgrund der Sozialisierung oder liegt es in der Natur?» Die Politikexpertin bilanziert: «Wenn wir eine diverse Gesellschaft haben, macht es grundsätzlich Sinn, dass ihre Gremien auch diverser sind.» Und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Auch wenn es die Sache vielleicht nicht immer einfacher macht.»
Wichtige Rekrutierung
Eine einzelne Frau auf fünf oder sieben Männer werde eher Aussenseiterin bleiben und den Stil kaum verändern. Das habe man auch beim Bundesrat gesehen: «Eine oder zwei Frauen müssen sich männlichen Dynamiken anschliessen.» Sei man aber zum Beispiel zu dritt in einem Siebnergremium, mache das einen Unterschied. Besser drei oder mehr Frauen als eine oder zwei – dafür spricht ein weiterer Punkt: «Die Forschung zu freiwilligem Engagement zeigt auf, dass bei beiden Geschlechtern eine der wichtigsten Motivationen ist, mit anderen zusammen etwas Positives zu machen.» Was bedeuten könnte: Wenn mehrere Frauen im Gemeinderat sind, bewegt das weitere Bürgerinnen eher dazu, sich auch zur Verfügung zu stellen, als wenn sie eine Einzelkämpferin als Rollenmodell haben. Gerade in Zeiten von «Milizkräftemangel» kein unbedeutender Punkt. Lösungsansätze gibt es, so Stadelmann: «Man muss Frauen aufbauen, nicht nur fragen. Ein Rekrutierungsgefäss sind zum Beispiel Kommissionen, wo Frauen ihre Fähigkeiten und Netzwerke aufbauen können.» Ein weiteres Gefäss sind Parteien. «In vielen Gemeinden hat es wenig Parteien. Da würde es helfen, Lokalsektionen zu stärken und insbesondere Frauen und Jüngere aufzubauen.» Das Problem der fehlenden Willigen für Kommissionen und Gemeinderäte ist weit verbreitet, so dürfte es von allgemeinem Interesse sein, in den Nachwuchs zu investieren – bei beiden Geschlechtern. Und hier zeigt sich ein weiterer Punkt: «Ältere Männer sind am wenigsten betroffen von Zeitmangel. Frauen mit Kindern hingegen am stärksten. Doch junge Männer, die vermehrt auch mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen und egalitär ausgerichtet sind, sind ebenso betroffen. Wäre die Arbeits- und Care-Arbeitslast ausgeglichener verteilt, gäbe es insgesamt mehr Möglichkeiten.»
Die Teilhabe von Frauen am öffentlichen Leben ist also Teil eines gesellschaftlichen Wandels. Dieser vollzieht sich gerade im ländlichen Gebiet eher langsam – aber er passiert. Dies betrifft, so erklärt Stadelmann, zum Beispiel latente Normen. Frauen wie Männer begeben sich in eine Rolle, weil man es sich so gewohnt ist. Dies sei oft ein subtiler Entscheid. Wer bringt die Kinder ins Bett, wer besucht derweil die Gemeindeversammlung? Wer exponiert sich, wer stellt Fragen zu einer Vorlage? Für das gebe es keine einfachen Lösungen. «Aber eine Gemeinde muss etwas dafür tun, dass sich mehr Frauen, aber auch mehr junge Männer engagieren. Denn wenn man die Kleinräumigkeit und das Milizsystem bewahren will, braucht es Leute, die sich engagieren.» Ansonsten bleibe irgendwann nur noch die Fusion und / oder die Professionalisierung.
«Bei gewissen Themen sensibilisierter»
«Es ist sehr wichtig, dass es einigermassen ausgeglichen ist», sagt die Rüeggisberger Gemeinderätin Christine Jenni (parteilos). Wenn aber untereinander die Chemie stimme, dann sei das Geschlecht nicht massgebend. Sie hat beides erlebt: Fünf Frauen und zwei Männer – und umgekehrt. Bei gewissen Themen spüre man eine unterschiedliche Sichtweise. Fabienne Nussbaum (SP), in ihrer dritten Legislatur im Rüschegger Gemeinderat, stellt fest: «Die meisten Frauen in meinem Alter sind familiär eingespannt und haben keine Zeit, um nebenbei noch ein Amt auszuüben. Aber viele haben auch Zweifel, empfinden Politik als kompliziert und zahlenlastig, sehen sie als Männersache.» Sie selbst sei vor ihrer Wahl «sehr naiv» gewesen und «fest auf die Welt gekommen». «Doch man muss sich dem stellen. Entweder man gibt auf, oder man nimmt die Herausforderung an und wächst daran.» Auch Jenni ist ein Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt. Nach zwölf Jahren in der Schulkommission, davon elf als Präsidentin, legte sie vier Jahre Pause ein. «Als ich mich wieder zur Verfügung stellte, waren die Kinder schon draussen und es ging vom Zeitaufwand her besser.» Sie findet es grundsätzlich richtig, dass im Gemeinderat alle vertreten sind: Junge, Alte, Männer, Frauen. «Das Problem ist: Wir hatten in den letzten Jahren Mühe, alle Sitze zu besetzen.» Aus diesem Grund wird der aktuell siebenköpfige Rat auf fünf verkleinert; in knapp zwei Jahren werden aufgrund der Amtszeitbeschränkung nur noch drei Bisherige – alles Männer – dabeisein. «Wir hoffen, dass wir noch zwei Frauen finden. Ich finde dies wichtig, denn es kommen immer wieder Themen hinein, die Männer gar nicht wahrnehmen.» Ähnlich spricht sich Nussbaum aus: «Bei gewissen Themen bin ich sensibilisierter. Aus meinem sozialen Umfeld weiss ich zum Beispiel um die Wichtigkeit eines Mittagstisches für Schulkinder. Da gewichten ältere Männer die Finanzierung stärker.» Diese Erfahrung bestätigen Rückmeldungen, die sie von Rüscheggerinnen erhält. «Vor allem, seit ich allein bin, drücken Frauen mir gegenüber aus, dass sie es schätzen, mich als Frau im Gemeinderat zu wissen.» Es nähme sie wunder, wie gross der Frauenanteil der für sie eingelegten Stimmen war. «Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Frauen, ob links oder rechts, ihre Lieblingskandidaten aufschrieben und dann noch mich als Frau.» Zumindest in nationalen Wahlen lässt sich klar sagen, dass mehr Frauen gewählt werden, je mehr Frauen wählen. In der letzten Legislatur war nebst Fabienne Nussbaum mit Daniela Zbinden (Uue) noch eine zweite Frau im Rat. «Bei gewissen Themen gingen auch bei uns die Meinungen auseinander. Aber wir waren einander gegenüber offen. Jetzt fühle ich mich eher allein. Es wäre schön, noch mindestens eine zweite Frau zu haben.» Wobei sie relativiert, dass sie gleich dreifach in der Minderheit ist: als Frau, als Linke und als Junge. Da sei es schwierig zu sagen, was am Geschlecht liege und was an anderen Aspekten.
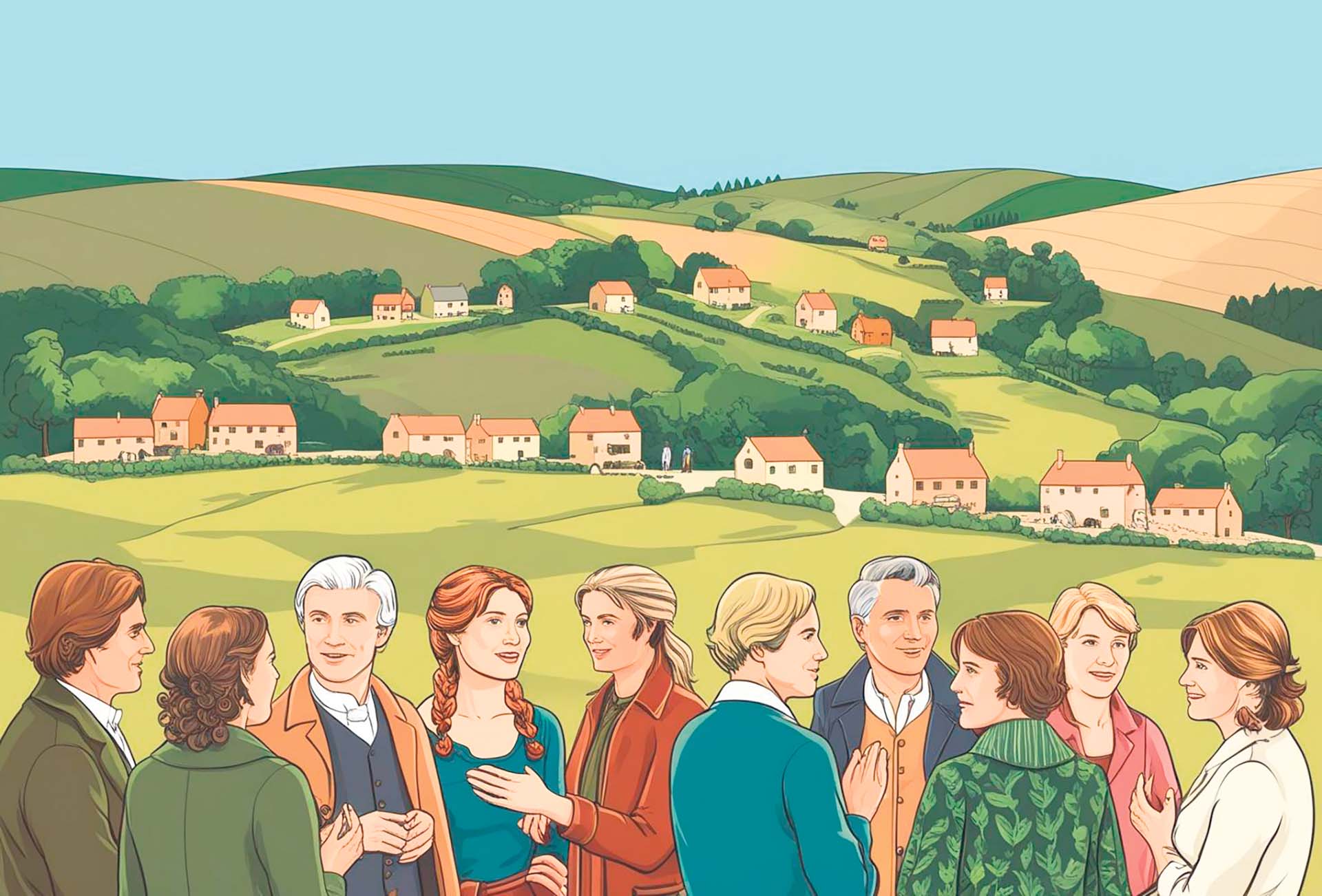
Wertgeschätzt – und angefeindet
Jenni ist nicht allein, mit Gemeindepräsidentin Therese Ryser (SVP) ist noch eine zweite Frau im Gremium. «Dass wir zu zweit sind, hilft bei manchen Themen sicher», sagt Jenni. Hingegen in der Baukommission, in der sie als Vorsteherin allein mit vier Männern ist, «dort ist es kein Problem. Da muss ich den Männern ein Kränzli winden.» Die Chemie untereinander sei gut, man verstehe sich. Therese Ryser findet das Thema grundsätzlich spannend. In Rüeggisberg sei der Gemeinderat während sechs Jahren in Frauenhand gewesen. Doch auch jetzt, als eine von zwei, «fühle ich mich als Frau wertgeschätzt und ernstgenommen». Themen würden unterschiedlich angegangen – unabhängig vom Geschlecht. Grösseren Einfluss habe das jeweilige Präsidium. In anderen, übergeordneten Zusammenhängen, habe sie erlebt, dass ihre Meinung aufgrund ihres Geschlechts nicht wahrgenommen oder einfach übergangen wurde. Dies aber in der Anfangszeit als Gemeinderätin, es habe sich stark geändert. Hingegen hätten, seit sie den Rat präsidiere, Vorfälle mit wütenden Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern zugenommen. «Ich wurde, weil ich eine Frau bin, unter der Gürtellinie beschuldigt und angefeindet. Bei einer Situation war ich kurz vor einer Anzeige bei der Polizei.» Die Familie sei immer hinter ihr gestanden, auch wenn es am Anfang grosse Bedenken gegeben hatte. Von anderen Frauen höre sie auch heute Aussagen wie: «Mit Kindern und Beruf kann ich mir ein Milizamt nicht vorstellen – ich könnte mich nicht vor eine Gemeindeversammlung stellen.» Dabei sei Gemeindepolitik interessant, man könne mitgestalten und miteinander etwas bewirken. Für Ryser sei das Miteinander wichtiger als die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern. Wünschenswert sei hingegen, dass sich Frauen mehr zutrauen und sich für ein Amt im Gemeinderat bewerben. Interessierten Frauen gibt sie den Rat: «Gebt euch selbstbewusster. Getraut euch, verkauft euch nicht unter Wert.»
Nachholbedarf
Kristin Arnold Zehnder (SP) war vier Jahre lang eine von zwei Frauen im Gemeinderat, seit dieser Legislatur ist sie allein mit sechs Männern. «Das macht einen grossen Unterschied», sagt die Belperin. Allerdings spielt hinein, dass die beiden Rätinnen vorher beide Mitte-links waren, mit einem ähnlichen Bildungshintergrund und in einem ähnlichen Alter. Dennoch: «Wir konnten in den Ratsdebatten die weibliche Perspektive immer wieder einbringen, sei es in der Bildung, beim Bauen oder in der Sicherheit.» Das sei heute anders. Sie stelle fest, dass Berufs- und Familienfrauen immer wieder eine andere Perspektive aufs Leben einnehmen. Besonders als Mutter: «Als ich noch kein Kind hatte, dachte ich, wir sind gleichberechtigt. Danach merkt man, nein, eben doch nicht.» Wer Familie und Beruf unter einen Hut bringen müsse, habe bald einmal eine andere Sicht auf die Gesellschaft. Väter, die hochprozentig daheim sind, gäbe es noch deutlich weniger als entsprechende Mütter. Darum brauche es aktuell noch verstärkt Frauen, die solche Blickwinkel einbringen. Dem Argument «Hauptsache, geeignete Leute» kann Arnold Zehnder nichts abgewinnen: «Es gibt geeignete Frauen, die sich ein Amt nicht zutrauen, die denken, dass sie mehr Kompetenzen haben müssten.» Sie mache die Beobachtung, dass Frauen ihre Fähigkeiten geringer schätzen als Männer die ihren. Im männerdominierten Belper Gemeinderat sei man sich bewusst, dass man auch die 50 % Frauen der Gesellschaft vertrete. «Sie geben sich Mühe, ich fühle mich ernstgenommen.» Als Vorsteherin des Sicherheitsdepartements hingegen habe sie sich aus der Bevölkerung einiges anhören müssen. «Es hiess zum Beispiel: ‹Überlass das lieber einem Mann.›» Das Nachwuchsproblem bei Frauen verortet auch Arnold Zehnder in der verbreiteten Teilzeitarbeit von Müttern: «Viele Frauen bewältigen die Doppelbelastung von Beruf und Familie, da ist ein zeitintensives politisches Amt kaum mehr möglich, zumal politische Veranstaltungen meist abends stattfinden.» Für einen Wandel wünscht sie sich, dass es mehr weibliche Vorbilder gibt. «Es ist immer noch tief verwurzelt, dass man als Mann ein Gemeinderatsamt einfach könne.» Frauen hingegen hinterfragten sich stärker. Deshalb rät sie Frauen, einer Partei beizutreten, sich in einer Kommission zu engagieren – «und dann in eine Exekutivposition gehen. Es ist wichtig, dass Frauen mitreden und mitbestimmen, und es gibt hier Nachholbedarf.»
Carolin Luginbühl (Forum), ist im Kirchdorfer Gemeinderat eine von zwei Frauen. «Meine Mutter musste viel mehr kämpfen, um die gleichen Rechte zu erhalten. Ich habe selten das Gefühl, dass ich wegen meinem Geschlecht anders behandelt werde. Männer sind häufig direkter, Frauen eher emotionaler.» Sie hat Kinder im Schulalter und ist aufgrund ihres Amtes abends öfter weg. Die Kinder hätten gelernt, dies zu akzeptieren. «Ich mache das auch für meine Töchter. Ich will ihnen zeigen: Es gibt auch diesen Weg.» Auch Judith Meister (KLdM) ist eine von zwei Frauen im Kehrsatzer Gemeinderat. «Ich finde die Vertretung von Frauen wichtig. In einer Arbeitsgruppe für einen Kindergarten zum Beispiel habe ich mich dafür eingesetzt, dass es nicht ein reines Männergremium ist. Es sollte überall versucht werden, alle Perspektiven einzubringen.»
Männer führungsstark, Frauen emotional
Zwei Volksvertreterinnen erzählen von Situationen, in denen nach einer Diskussion klar war, dass die Männer «einen Bock geschossen hatten», aber nicht dazu stehen konnten. «Alle anderen waren die Blöden.» Frauen seien in solchen Situationen reflektierter und könnten eher sagen, wenn sie etwas nicht so gut gemacht hätten. Eine andere Gemeinderätin, die ebenfalls anonym bleiben möchte, erzählt: «In der Öffentlichkeit lobt man mich, doch hintendurch gibt man mir zu verstehen, dass ich dünnhäutig bin, wenn ich mich wehre. Sind die Herren unbequem, stört das nicht, bin ich es, werde ich als emotional betitelt.» Eine weitere Gemeinderätin berichtet ähnlich. Eine heftige Reaktion von ihr sei als «mimosenhaft» betitelt worden, dasselbe von einem Mann hingegen nicht negativ aufgefallen.
Für eine breitere Vertretung
Urs Rohrbach (Grüne) präsidiert den derzeit einzigen Gemeinderat, der mit fünf Frauen weiblich dominiert ist. Als er 2013 neu Gemeinderat wurde, war die Exekutive mit sieben Herren ein reiner Männerclub. Dies hat sich deutlich geändert. Nach dem reinen Männerrat hätten sich viele im Dorf für einen Wandel eingesetzt und bewusst Frauen auf die Listen gesetzt – von links bis rechts. «Die Diskussionen sind in der Tendenz tiefgründiger, man hinterfragt Sachen anders», beschreibt er einen Unterschied, den er wahrnimmt. Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik sei durchaus ein Thema. Nur dank der Tatsache, dass die meisten Ratsmitglieder Teilzeit arbeiten, könne die Ratssitzung an einem Nachmittag stattfinden – was das Amt wiederum den Frauen einfacher mache. «Wir ziehen gemeinsam am ‹Chare›», betont er.
Man hätte noch mehr Gemeinderätinnen befragen und noch mehr Ratskollegen anhören können. Spannend wären die Sichtweisen allemal. Manches sind einzelne Anekdoten, anderes Beispiele einer weit verbreiteten Realität. Bilanzieren lässt sich, dass die Lebensrealitäten der politischen Führungskräfte sich auf ihr Amt auswirken. Und dass diese Realitäten für Frauen häufig frappant anders aussehen als für Männer. Eine Politik, die breit abgestützt ist, ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Das Schlusswort soll Christine Jenni haben: «Die Arbeit im Gemeinderat ist wirklich spannend. Ideal wäre es, alle Altersstufen vertreten zu haben, Männer und Frauen im Gleichgewicht. Frauen, versteckt euch nicht unter dem Tisch.»



