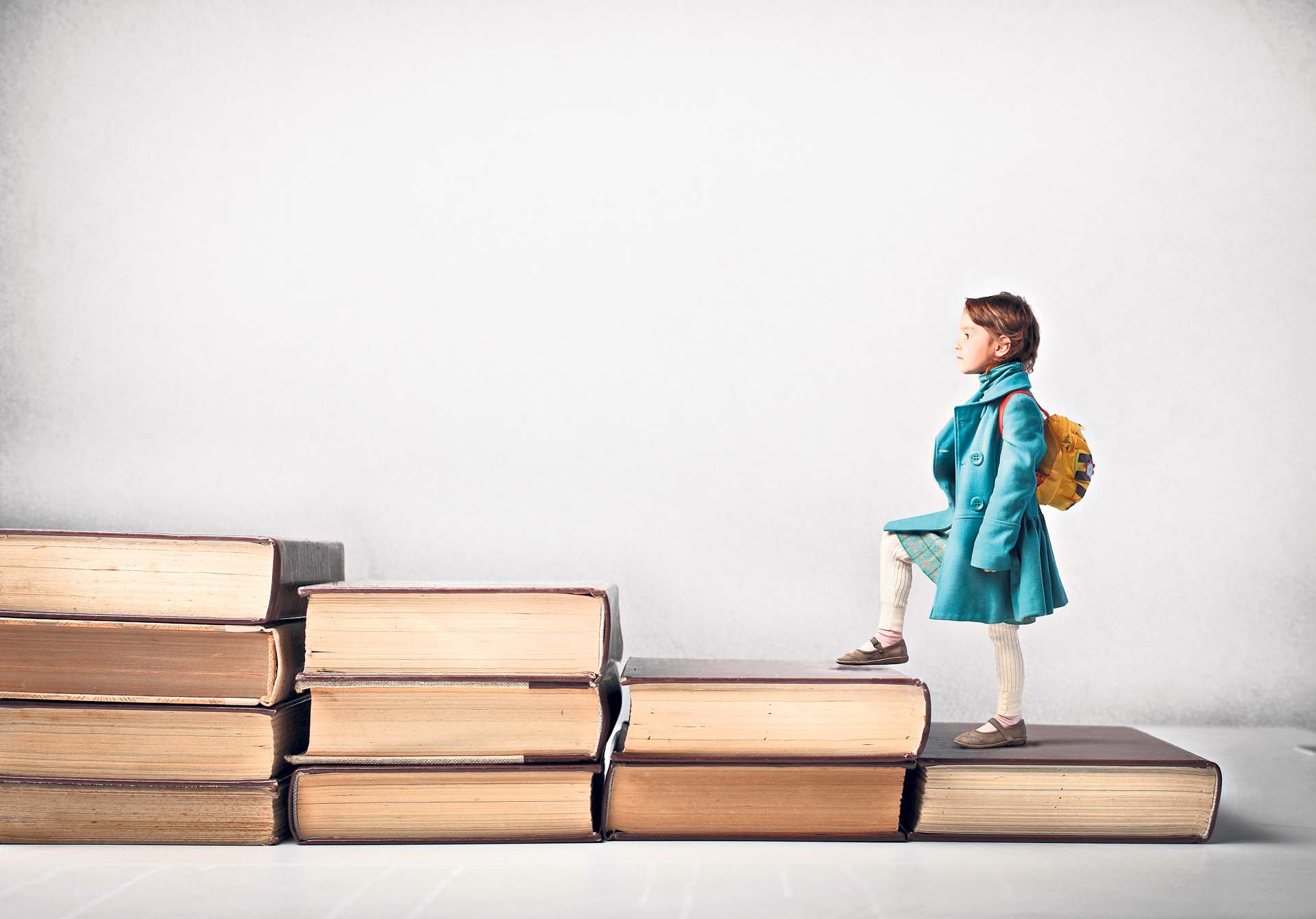Weltweit haben mehr als 250 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung. Der Unesco-Weltbildungsbericht von Mitte Juni zeigte auf, dass Armut und der Zugang zu Bildung zusammenhängen.
In der Schweiz wurde die allgemeine Schulpflicht 1874 eingeführt. Genf hatte diesen Schritt bereits 1536 getan, Bern 1615 und Zürich 1637. Vielerorts beschränkte sich der Unterricht aufs Lesenlernen, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts brachten Reformen die Grundlage dessen, was wir heute als Schule kennen.
Die Zuständigkeiten
Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern ist mit den Gemeinden gemeinsam für die Volksschule sowie deren Finanzierung verantwortlich. Die Löhne der Lehrpersonen werden zu 70% vom Kanton und zu 30% von den Gemeinden übernommen.
Die Kantone geniessen grosse Autonomie im Bildungswesen. Jedoch wurden in den letzten Jahren die Lehrpläne immer mehr vereinheitlicht, hauptsächlich mit dem 2014 freigegebenen Lehrplan 21 – die Zahl 21 steht hierbei nicht für das Kalenderjahr, sondern für die deutsch- und mehrsprachigen Kantone, die dabei mitmachen.
Das duale Bildungssystem
Es ist weltweit einzigartig: das Schweizer «duale Bildungssystem». Es bedeutet zusammengefasst, dass jedes Kind nach der 9. Klasse in die Sekundarstufe II übertritt: Dies ist entweder eine Berufsausbildung; meist eine Lehre, oder eine Mittelschule wie das Gymnasium. Dieser Entscheid muss nicht das ganze Erwerbsleben prägen; jederzeit steht der Wechsel in den anderen Bereich offen: Eine Lehrabgängerin kann etwa die Berufsmatur machen und anschliessend an einer Fachhochschule einen Bachelor oder Master absolvieren, während ein Unistudent jederzeit in eine Berufslehre wechseln kann – oft sogar abgekürzt.
(Besondere) Volksschule
Die Volksschule – also die «normale» öffentliche Schule – untersteht der Bildungs- und Kulturdirektion, während die Sonderschulen – etwa heilpädagogische Tagesschulen, Sprachheilschulen oder Schulheime – zurzeit noch zur Gesundheitsdirektion gehören. Dies wird fast gesamtschweizerisch anders geregelt und verstösst gegen das Gleichstellungsgesetz des Bundes. Kinder, welche die Volksschule nicht besuchen können, werden durch eine besondere Volksschule anderweitig geschult. Ihre Eltern müssen für sie einen Platz an einer Sonderschule finden. Nun werden aber die rund 60 Sonderschulen im Kanton 2022 als «besondere Volksschulen» Teil der Volksschule unter dem Dach der Bildungs- und Kulturdirektion. Damit müssen die Eltern nicht mehr selber einen Platz für ihr Kind suchen.
Erwin Sommer ist Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung AKVB.
Erwin Sommer, der «Lehrermangel» ist in aller Munde. Wie sieht es im Kanton Bern und speziell in der Region Gantrisch aus?
Im Kanton Bern gibt es einen Mangel an Lehrpersonen. Die Stellenbesetzung in der Region Gantrisch unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Regionen. Auch hier ist die Besetzung von Stellen in der Heilpädagogik herausfordernd. Bisher konnten jeweils alle Stellen besetzt werden, in der Regel durch qualifizierte Lehrpersonen. Es mussten keine Klassen zusammengelegt werden. Einzelne wenige Stellen wurden über die PH Bern mit Studierenden besetzt. Es gibt kaum Unterschiede zwischen grösseren und kleineren Gemeinden.
Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für Randregionen wie der Region Gantrisch im Hinblick auf die Volksschule?
Die Region Gantrisch ist (vielleicht zunehmend) attraktiv wegen ihrer ländlichen Lage und den kurzen Distanzen zu Bern, Thun und dem Freiburgerland. Diesen Vorteil gilt es vermehrt bekanntzumachen und auszuspielen. Ein gewisser Nachteil kann sein, dass eine Lehrperson, die in verschiedenen Schulhäusern unterrichtet, auf ein motorisiertes Fahrzeug angewiesen ist.
Welche Neuerungen erwarten uns in den nächsten Jahren?
Die grösste Neuerung, der Lehrplan 21, ist soeben eingeführt. Eine wichtige Neuerung in Zukunft wird der Transfer der Sonderschulen von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) zur Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) sein.